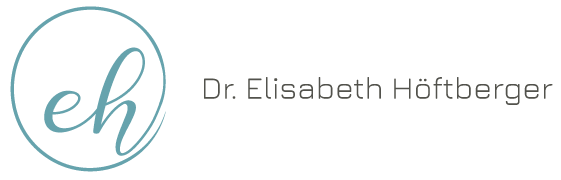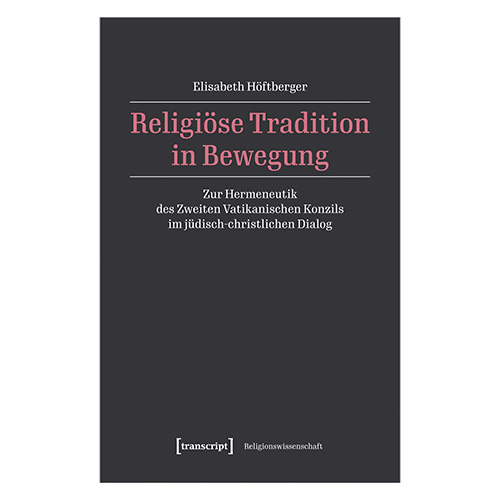- Religiöse Tradition in Bewegung. Zur Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils im jüdisch-christlichen Dialog. Bielefeld: transcript 2023. Open Access.
Traditionen sind dynamisch und vielgestaltig. Die Haltung der Kirche zum Judentum erfuhr durch das Zweite Vatikanische Konzil mit der Erklärung Nostra aetate eine positive Wende. Wie können diese tiefgreifenden Veränderungen und die hier beobachtbare Traditionsdynamik beschrieben und gedeutet werden? Mein Buch soll durch eine kulturwissenschaftlich reflektierte theologische Traditionstheorie einen neuen Blick auf kirchliche und religiöse Traditionen eröffnen. Mit der entworfenen dialogsensiblen Traditionshermeneutik und Rezeptionstheorie biete ich Deutungsalternativen zu Polarisierungen wie Bruch und Kontinuität und möchte einen Beitrag zu einer interdisziplinären Theologie leisten.
Medienecho und Rezensionen
Höftbergers Werk bringt unterschiedlichste Ansätze und Einsichten aus verschiedenen Disziplinen zur Geltung und lässt Zusammenhänge auf der Grundlage dieser Analysen neu verstehen. Sie selbst stellt heraus, dass es sich um »eine Sammlung und Synthese von Impulsen aus verschiedensten theologischen Richtungen, methodologischen Herangehensweisen und kritischen Anfragen« (S. 305) handelt. Hierbei liegt die Besonderheit ihrer Arbeit jedoch gerade in diesem Ansatz, verschiedene Impulse auch unterschiedlichster Fachrichtungen ins Gespräch zu bringen und damit bisher Bekanntes kritisch zu betrachten und anzufragen.
Dadurch ermöglicht Elisabeth Höftberger, bisherige Vorstellungen neu zu strukturieren, Unbewusstem bewusst zu werden, Bilder aufzubrechen und den Weg für alternative Denkwege zu schaffen. Höftbergers Arbeit stellt selbst ein wichtiges Element im andauernden Prozess der Rezeption und Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils dar – wobei zu hoffen ist, dass ihre Arbeit nicht nur in der systematischen Theologie, sondern weit darüber hinaus eine breite Rezeption erfährt und Neues in Bewegung setzt. Online verfügbar auf JC-Relations.netElisabeth Migge. In: Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung im Kontext, 1/2 2024
Höftbergers Studie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung neuer Antworten auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kirche, sich zwischen Tradition und notwendiger Reform neu zu verorten. Das Leitwort heißt: Dialog. Für Theolog:innen und Praktiker:innen des interreligiösen Dialogs, die sich fundiert mit der Hermeneutik des Konzils auseinandersetzen möchten ist dieses Buch eine wertvolle Ressource, die auch open-source kostenlos heruntergeladen werden kann.
Thomas Sojer. In: Theologie der Gegenwart 67 (2024) 4, 317–318.
Der Fokus auf die kirchlich umstrittene und gesellschaftlich relevante Frage nach dem Verhältnis zu Judentum und Israel erweist sich jedoch als besonders fruchtbar. Damit kommen offenbarungstheologische Grundvoraussetzungen des christlichen Glaubens in den Blick. Ein zentraler blinder Fleck der Tradition wird bewusst gemacht, der bis heute Ungerechtigkeit schafft. Die Studie zeigt, dass die Beziehung der Kirche zum Judentum nicht ein Spezialgebiet ist, sondern als Querschnittsthema und als hermeneutische Klammer die gesamte Theologie betrifft.
Online verfügbarChristian Rutishauser. In: Crosscultural Studies of Religion and Theology, (2024) H. 1.
Interview mit dem Verlag zu meinem Buch
1. Warum ein Buch zu diesem Thema?
Ob in medialen oder kirchenpolitischen Diskussionen, oft wird „Tradition“ herangezogen, um politische oder theologische Standpunkte zu legitimieren. Was mit diesem Konzept aufgerufen wird, bleibt häufig unklar. Religiöse Traditionen gelten meist als unbeweglich. Am Verhältnis von Christentum und Judentum wird besonders deutlich, dass diese durchaus in Bewegung sind – eine wichtige Beobachtung angesichts immer wieder auftauchender fundamentalistischer Tendenzen von religiösen Gruppierungen.
2. Welche neuen Perspektiven eröffnet Ihr Buch?
Das Schwierige an der Analyse von Traditionen ist, dass wir immer schon mittendrin stecken. Kulturwissenschaftliche und philosophisch-dekonstruktive Theorien können helfen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Vielschichtigkeit religiöser Traditionen offenzulegen. Der jüdisch-christliche Dialog gibt dafür spannende Anregungen. Interreligiöser Dialog wird oft als Spezialthema gesehen, dabei können Wissenschaft und Gesellschaft daraus viel lernen.
3. Welche Bedeutung kommt dem Thema in den aktuellen Forschungsdebatten zu?
Die Anwendung kulturwissenschaftlicher Theorien in der Theologie nimmt seit einigen Jahren zu. Meine Forschungen knüpfen daher an ein wachsendes Interesse an interdisziplinärer Auseinandersetzung an. Problemfelder wie ein wieder ansteigender Antisemitismus und religiöse Konflikte benötigen eine wissenschaftliche Reflexion von Glaubenserfahrungen. Ein dialogsensibler Blick auf religiöse Traditionen, den das Buch eröffnet, stellt eine wichtige Ergänzung in diesen Diskursen dar.
4. Mit wem würden Sie Ihr Buch am liebsten diskutieren?
Mit allen, die es gelesen haben – und jenen, die sich eine Lektüre nicht vorstellen können, mit Menschen unterschiedlicher religiöser und nichtreligiöser weltanschaulicher Überzeugungen, mit Personen, die sich in verschiedener Weise mit einer Religion identifizieren, die sich als agnostisch oder areligiös verstehen. Gerade wenn wir über die Bewegung religiöser Traditionen sprechen, erweitert jede Perspektive den eigenen Horizont.
5. Ihr Buch in einem Satz:
Eine Einladung, neu – dialogsensibel – auf religiöse Tradition(en) zu schauen und dadurch Gewohntes, Machtprozesse und eingefahrene Denkmuster zu überwinden.