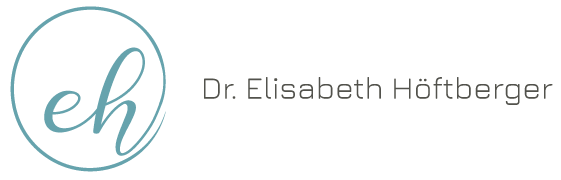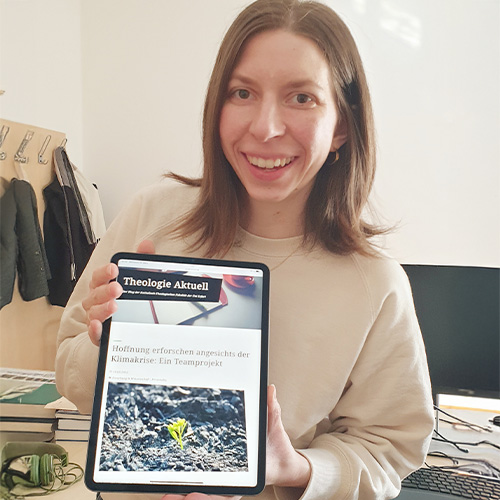I proudly present: Interview mit meinem Team der Universität Salzburg und der Universität Erfurt als Auftakt einer 4-teiligen Serie über das aktuelle Projekt zu Hoffnungsforschung, Theologie und Klimakrise im Blog „Theologie aktuell“ der Universität Erfurt.
Worüber sprechen Dominique-Marcel Kosack, Andrea Maria Schmuck, Mark Porter und ich?
- Klimaforschung als multidisziplinäres Feld
- Warum wollen und müssen sich Theolog:innen und Religionswissenschaftler:innen mit dem Thema beschäftigen?
- Wie funktioniert Teamwork hybrid und wie sieht unsere digitale Kaffeepause aus?
- Was bedeutet „refiguring hope“?
Hier ein Auszug aus dem Interview
Im Projekt „Theologie als Hoffnungsforschung? Auswirkungen der Klimakrise auf theologische Reflexion und religiöse Praxis“ arbeiten seit April 2024 Nachwuchswissenschaftler*innen der Universität Erfurt und der Paris Lodron Universität Salzburg zusammen, um die Auswirkungen der Klimakrise auf die theologische Forschung und die religiöse Praxis zu erforschen. Andrea Schmuck, Mark Porter, Dominique-Marcel Kosack, Elisabeth Höftberger und Studienassistent Moritz Huber versuchen nicht nur zu verstehen, welche Rolle Hoffnung bei der Bewältigung der Klimakrise spielt, sondern auch wie die Theologie im Dialog mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen komplexe Phänomene untersuchen kann.
Welche grundlegenden Fragen sollen im Rahmen des Projekts beantwortet werden?
Elisabeth: Die Klimakrise verändert, wie Menschen ihre Lebenssituation in der Gegenwart sehen und wie sie in die Zukunft blicken. Das schließt auch die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens und die Hoffnung für zukünftige Generationen mit ein. Wir interessieren uns dafür, wie sich Erzählungen und Vorstellungen von Hoffnung sowohl in religiöser Praxis als auch im theologisch-akademischen Bereich durch die ökologische Krise verändern. Welche Spannungen und Möglichkeiten entstehen dadurch? Mit der Frage nach Hoffnungsnarrativen im Angesicht der Klimakrise wollen wir einen wichtigen Teil der Klimafolgenforschung umsetzen. Wir fragen nach “refiguring hope”, also danach, wie angesichts dramatischer ökologischer Umbrüche neue Formen der Hoffnung entstehen, die sich vielleicht ganz anders zeigen, als wir erwarten würden, – und wie sich Hoffnungskonzepte theologisch weiterentwickeln lassen.
Andrea: Da die Klimaforschung ein multidisziplinäres Feld ist, fragt das Projekt auch danach, wie Theolog*innen und Wissenschaftler*innen aus klimabezogenen Disziplinen in einen guten Austausch kommen können und wie ein inter- und transdisziplinäres Arbeiten gestärkt werden könnte.
Theologie ist keine Wissenschaft, die man auf Anhieb mit Forschung zur Klimakrise verbindet. Was genau kann Theologie in diesem Bereich einbringen und welche konkreten Bezüge ergeben sich zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen?
Dominique: Bei der Forschung zum Klimawandel geht es ja nicht allein um naturwissenschaftliche und technische Fragen. Der Grund, warum wir Menschen so viel über dieses Phänomen wissen und sich dennoch wenig ändert, liegt nicht zuletzt in der Art von Beziehung, die wir zur nicht-menschlichen Natur entwickelt haben. Solange die Natur vor allem als Instrument und Ressource für die eigenen Zwecke erscheint, reproduzieren wir jene Strukturen und Verhaltensweisen, die sie zerstören. Um mit diesem Problem umzugehen, benötigen wir Kompetenzen, die sich besonders in den Geisteswissenschaften finden. Aus diesem Grund haben sich etwa die multidisziplinären Environmental Humanities entwickelt. Und gerade die Theologie mit ihrer Reflexion von Weltverhältnissen, großen Erzählungen und religiösen Deutungen des Menschen und der nicht-menschlichen Natur kann hier wichtige Einsichten bringen.
Andrea: Die Grundproblematik des menschengemachten Klimawandels und der ökologischen Krisen liegt also tiefer als unser problematischer Ressourcenverbrauch oder CO2-Ausstoß. Religionen spielen dabei eine ambivalente Rolle. Als christliche Theolog:innen müssen wir deshalb zunächst unsere eigene Tradition kritisch hinterfragen. Denn Deutungen biblischer Motive und Vorstellungen von Mensch und Natur in westlichen Kulturen, wie etwa die Auslegung der biblischen Schöpfungserzählung, haben mit dazu beigetragen, ein starkes Trennungserleben zwischen Mensch und Natur zu verfestigen. Gleichzeitig bergen Religionen einen reichen Schatz an alternativen Erzählungen, die uns neue Perspektiven auf unsere Beziehung zur Natur eröffnen und zu einer veränderten Wahrnehmung anleiten können.
Dominique: Hinzu kommt, dass der Umgang mit dem Klimawandel für Wissenschaftler:innen oft eine starke existenzielle Betroffenheit mit sich bringt. Wir erforschen hier etwas, zu dem wir nur begrenzt in eine innere Distanz treten können, da es die Grundlagen unseres eigenen Lebens und teils auch aktivistische Interessen betrifft. In der Theologie haben wir es zum Teil mit ähnlichen Phänomenen zu tun, da die erforschte Religion zugleich eng mit persönlichen Sinnfragen verknüpft sein kann.
Elisabeth: Hier besteht mittlerweile eine ausgeprägte Kompetenz, diese eigene Betroffenheit und deren Einfluss auf die Forschung zu reflektieren und methodisch adäquat damit umzugehen. Dies ist auch für die Forschung zum Klimawandel sehr hilfreich.
Die Fragen stellte Sophie v. Kalckreuth von der Wissenschaftskommunikation der Uni Erfurt.